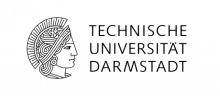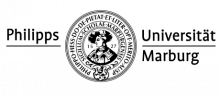Elektronische und phononische Struktur der Kupferoxide
Introduction
Halbleiterstrukturen basierend auf Kupferoxiden sind insbesondere für die Solartechnologie vielversprechende Kandidaten. Man unterscheidet drei kristallographische Phasen dieser Oxide des Kupfers: Kuprit, Tenorit und Paramelaconit, wobei letztere eine eher instabile Phase darstellt und chemisch zwischen den beiden Erstgenannten anzusiedeln ist. Kuprit ist als die erste halbleitende Kristallphase bekannt. Diese oxidischen Strukturen sind in den letzten Jahren in den Fokus wissenschaftlicher Forschung gerückt, insbesondere vor dem Hintergrund ihrer Attraktivität für die solartechnische Anwendungen.
Methods
Auf experimenteller Ebene wurden besonders Präparationsverfahren für die Herstellung von Dünnschichten im Nano- bis Mikrometerbereich der drei Phasen entwickelt. Theoretische Betrachtungen haben sich verstärkt auf die elektronische Struktur der Kupferoxide konzentriert, um die Verwendbarkeit dieser Materialien für Solarzellen zu untersuchen. Die atomaren Schwingungszustände dieser Materialien sind allerdings noch nicht erschöpfend betrachtet worden. Kollektive Schwingungen der Atome auf dieser Größenskala (10-10m) werden als Phononen bezeichnet. Innerhalb dieses Projektes wurde die Phononenstruktur dieser Materialien ausführlich auf der Basis von ab-initio Berechnungen untersucht und in Zusammenarbeit mit dem Experiment präsentiert. Grundlage der ab-initio Rechnungen ist die Dichtefunktionaltheorie welche eine rein quantenmechanische Betrachtung der Kupferoxide ermöglicht. Mittels dieser Methode wurden die Schwingungsspektren berechnet. Das dazu verwendete Softwarepaket ist das kommerzielle Vienna ab-initio Simulation Package (VASP). Ein besonderer Schwerpunkt lag auf der Berechnung von Raman- und Infrarotspektren.
Results
Wir haben eine Methodik entwickelt, welche die reproduzierbare und rechnerisch effiziente Berechnung dieser Spektren erlaubt. Die Raman-Spektroskopie ist eine experimentelle Methodik, die auf der Streuung von Licht an Festkörpern beruht. Insbesondere im Falle des Kuprit zeigt das Ramanspektrum mehrere Anomalien, da es durch atomare Fehlstellen geprägt ist. Im Rahmen einer detaillierten Analyse konnten wir in diesem Projekt dazu beitragen, die Art und Struktur dieser Defekte näher zu beleuchten.[1] Weiterhin haben wir für alle drei Kristallphasen Raman- und Infrarotspektren berechnet,[2] was bis dato noch nicht in der Literatur existiert. Eine theoretische Berechnung solcher Spektren ist auch für experimentelle Betrachtungen wichtig, da sie Voraussagen treffen und bestehende Unklarheiten klären können.
Outlook
In Zukunft werden die Ramanspektren von Defektstrukturen der Kupferoxide Gegenstand näherer Betrachtung sein. Zudem sind die physikalischen Linienbreiten der Resonanzen in den Raman- und Infrarotspektren von Interesse, welche in den gegenwärtigen Untersuchungen noch nicht berücksichtigt sind. Diese Linienbreiten werden unter Verwendung anharmonischer interatomarer Kraftkonstanten errechnet und erlauben einen besseren Vergleich zwischen berechneten und experimentellen Daten.